
Wie weit wir sein könnten ohne die Verhinderungspolitik …
Franz Gerhard, leidgeprüftes Bauausschuss- und Kreistagsmitglied, berichtet in unserer Kolumne.
von Franz Gerhard erschienen am 15.10.2025Wir reden in Deutschland häufig über ausufernde Bürokratie. Viel schlimmer empfinde ich im Alltag jedoch etwas, das allgemein unter dem Begriff „Verhinderungspolitik“ bekannt ist – eine abstruse Melange aus Unentschlossenheit, Taktik und fehlendem Einigungswillen auf der einen Seite und einer Verwaltung auf der anderen Seite, die sich vor einer zielorientierten Entscheidungsfindung scheut. Dann heißt es oft „Beteiligungsprozesse brauchen Zeit“, „es handelt sich um komplexe Verfahren“ oder „man möchte keine voreiligen Entscheidungen treffen“. Vermutlich haben die Dinosaurier auch so argumentiert, als damals ein Asteroid auf der Erde eingeschlagen ist.
Aber nicht nur das Hinauszögern von Entscheidungen ist ein Problem, denn vielen geht es um mehr: Sie wollen ein Projekt am liebsten gänzlich verhindern. Am besten geht das, wenn man die Sinnhaftigkeit von Projekten infrage stellt oder noch so absurde „Alternativen“ einfordert. Zum Beispiel die Neubautrasse der Bahn zwischen Hamburg und Hannover, die sich nach langjährigen Untersuchungen als vorteilhafteste Variante erwiesen hat, abzulehnen und stattdessen den Ausbau einer Strecke zu fordern, die kaum Entlastung und Fahrtzeitgewinne bringt. Auf den sonst üblichen China-Vergleich „die Strecke hätte man dort bereits vor 10 Jahren begonnen zu planen, vor 9 Jahren zu bauen und vor 8 Jahren fertiggestellt“ möchte ich hier lieber verzichten.
Vielleicht könnte man derartige Auswüchse häufiger humorvoll nehmen, wären sie nicht Alltag. Zum Beispiel in unserem Ort: Ein Investor hatte sich im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages dazu verpflichtet, einen unbefestigten Radweg durch einen Wald, der auch als Anliegerstraße genutzt wird, auszubauen. 4 m breit sollte er sein. Da eine parallel verlaufende Straße in Bälde ebenfalls ausgebaut und dafür länger gesperrt werden muss, machte der Investor das Angebot, den Radweg auf seine Kosten(!) auf 5,5 m Breite auszubauen, sodass man den Weg zeitweise als Umgehungsstraße nutzen könne.
Ohne ein paar Baumfällungen wäre dies aber nicht möglich, wurde alsbald einigen klar. Andere fragten sich, warum man später Radwege mit einer Breite von 5,5 m Breite bräuchte. Statt das Angebot entweder a) anzunehmen oder b) abzulehnen, entschied man sich für c): Die Verwaltung sollte noch einmal prüfen, ob man den städtebaulichen Vertrag neu verhandeln und etwas ganz anderes als Kompensation für das Bauprojekt des Investors einfordern könne.






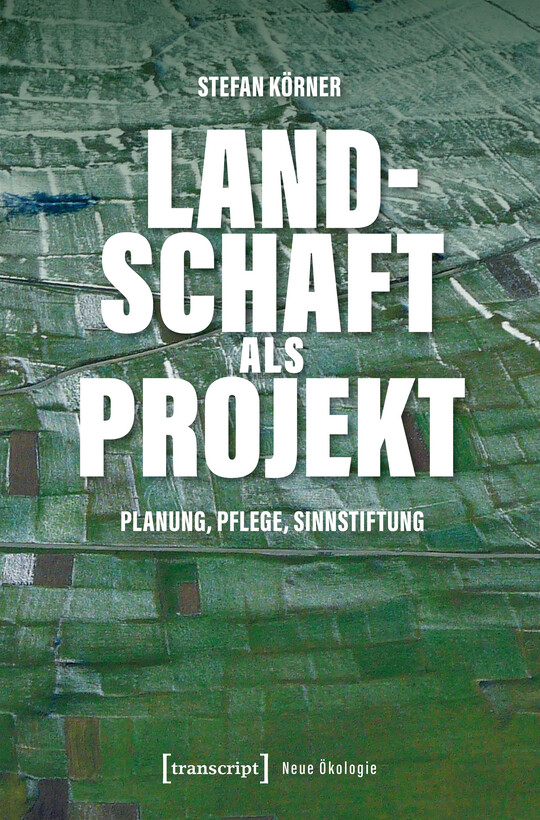
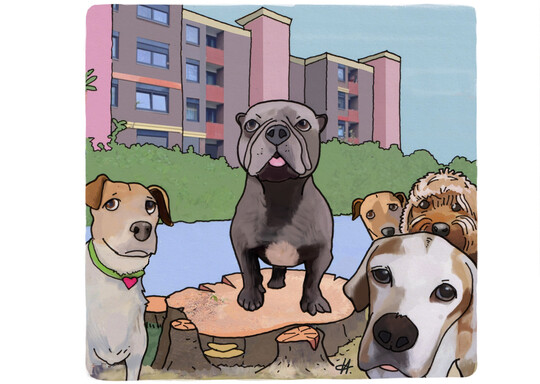




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.