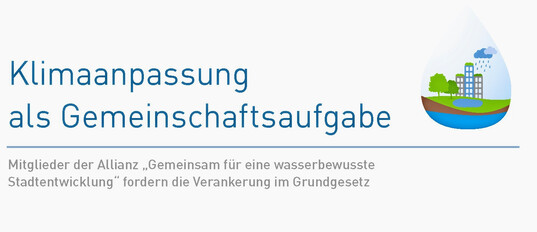
Bauen und Testen fürs Stadtklima
Trotz der vielfach betonten Dringlichkeit geht der klimasichere Umbau der Städte nur schleppend voran. Um so erfreulicher sind Kommunen wie die Stadt Bern, die experimentierfreudig und impact-orientiert neue Lösungen testet. Was läuft da anders? Ein Besuch vor Ort inspiriert auch Gäste aus Deutschland.
von Katja Richter erschienen am 14.04.2025Beim Blick über den Tellerrand, respektive Grenzen, lässt sich immer etwas lernen. Für eine Gruppe interessierter Laien, städtischer Mitarbeiterinnen und Vertretern von Bürgerinitiativen aus dem badischen Freiburg bot sich 2024 eine grenzüberschreitende Studienfahrt nach Bern. Die Hauptstadt im Nachbarland hatte immer wieder mit innovativen Konzepten zur klimasensiblen Stadtentwicklung auf sich aufmerksam gemacht. Bei Vorträgen der einzelnen Fachbereiche der Direktion Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS) in der bezaubernden Elfenau, einem der Standorte von Stadtgrün Bern, eröffneten sich für die Freiburger und Freiburgerinnen neue Horizonte und ein reger Austausch klärte viele Fragen.
Klimaanpassung als Querschnittsaufgabe
„Die Klimaerwärmung ist in Bern schon deutlich zu spüren“, belegt Corina Gwerder, Co-Leiterin der Fachgruppe Klimaanpassung bei Stadtgrün Bern, in ihrem Einführungsbeitrag mit Folien und Daten. Aufgrund der geografischen Lage haben die Durchschnittstemperaturen bereits ein Plus von 2,5 °C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit erreicht, mehr, als im Klimaprotokoll von Kyoto als internationaler Grenzwert vereinbart wurde: „Die direkten Auswirkungen wie sommerliche Hitzeperioden mit Trockenheit und Wolkenbrüchen erhöhen den Druck, Anpassungsmaßnahmen schnell voranzubringen.“
Ein in vielen deutschen Städten immer wieder vorgebrachtes Hindernis bei der Umsetzung der Schwammstadt sind die ungeklärten Zuständigkeiten der einzelnen Ämter. Bern hat das bereits gelöst: In der Direktion TVS trifft sich der Fachbereich Stadtklima regelmäßig: Er prüft alle Projekte der Direktion TVS auf stadtklimatische Aspekte und macht Verbesserungsvorschläge. So ist die Verständigung zwischen Tiefbaubelangen, der Fachgruppe „Klimaanpassung Stadtgrün“ und der Verkehrsplanung fest verankert. Der für die Schwammstadt relevante Bereich Siedlungsentwässerung/Gewässer/Grundwasser ist in der Stadt Bern schon von jeher Teil des Tiefbauamtes, die Wege zu Schnittstellen im Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün waren demnach auch vor Etablierung des Fachbereichs Stadtklima relativ kurz. Für die Delegation aus Freiburg ein Aha-Effekt, ist doch in der badischen Kommune die Klimaanpassung im Umweltschutz angesiedelt, der traditionell eher wenig zu sagen hat.
Als Instrumente für die Klimaanpassung hat Bern etliche Richtlinien und städtische Vorgaben grundsätzlich überarbeitet. Ein Klimareglement mit Energie- und Klimastrategie 2025 existiert bereits, die Folgestrategie für 2035 ist in Bearbeitung. Im Rahmen eines konkretisierten Gegenvorschlags zur Schweizer Stadtklima-Initiative entstand ein Klimaanpassungsreglement, das noch 2025 in Kraft treten soll. Herzstück und Leitlinie für die Klimaanpassung im öffentlichen Raum ist das operative Arbeitsinstrument „Bern baut“, vorrangig gedacht für Fachpersonen, die im öffentlichen Raum planen, projektieren und bauen. Darin stehen einheitliche und verbindliche Prinzipien zu Straßenraumlayout, Oberflächen, Vegetation, Wasserhaushalt und Ausstattungen. Der übergeordnete, ganzheitliche Ansatz stärkt ein gemeinsames Klimabewusstsein in den Ämtern der Direktion TVS. „Im Mittelpunkt der Stadtentwicklung der Zukunft steht immer der Mensch und seine Gesundheit“, ist die Kernaussage des Animationsvideos der Stadt. Ein Grundsatz, der die autogerechte Stadt der letzten Jahrzehnte endgültig ablöst und die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Begegnung und Erholung haben Vorrang und jeder muss sicher unterwegs sein können.
1Beispiel Baumpflanzungen Schosshaldenfriedhof
Weil für die neuen Aufgaben, die der menschengemachte Klimawandel mit sich bringt, noch kaum evaluierte Lösungen vorliegen und die Zeit für wissenschaftliche Langzeitstudien knapp wird, dienen Real-Labore als Pilotprojekte. Dafür braucht es eine fehlerpositive Haltung. „Wir testen und werden Fehler machen. Aber das bringt uns alle schneller weiter“, sagt Tobias Würsch, stellvertretender Fachleiter und Leiter Entwicklung und Realisation bei Stadtgrün Bern.
Ein Beispiel sind die neuen Baumpflanzungen am Schosshaldenfriedhof. Ein ehemals vollflächig versiegelter, unbeschatteter Parkplatz wurde im letzten Jahr im Sinne der Schwammstadt umgebaut. Alle Stellplätze sind jetzt mit Rasenlinern wasserdurchlässig gepflastert und mit verschiedenen Ansaatmischungen versehen. Die Fahrspur wurde mit Sickerasphalt ausgeführt. Im Mittelstreifen stehen fünf Linden in einem biodiversen Grünstreifen. Für besseres Wurzelwachstum und eine längere Lebenserwartung der Bäume ist der Standort mit Speichersubstrat unterbaut, das sich an der Stockholmer Skelettbodenbauweise, also Grobschotter vermischt mit feinkörnigeren Substrat-Bestandteilen, orientiert. Das Besondere sind zwölf Nährstofflinsen außerhalb des Grünstreifens. Die mit Bodensensoren und Wurzelrohren bestückten Bereiche sollen zeigen, inwieweit das Wurzelwachstum bewusst gelenkt werden kann. Weitere Forschungsfragen sollen klären, welche Unterschiede nach einem Regenereignis in den unterschiedlich überbauten Flächen festzustellen sind und wie lange Sickerasphalt und Rasenliner ihre Aufgabe der Wasserdurchlässigkeit überhaupt erfüllen.
2Einbinden der Bürgerschaft
Ein Knackpunkt der klimagerechten Stadtentwicklung ist immer wieder die fehlende Akzeptanz der Anwohnenden. Oftmals leistet ein öffentlicher Raum nicht, was er soll. Die neue Nutzung des öffentlichen Raums ist für viele ungewohnt und stößt nicht automatisch bei allen auf Begeisterung. Das Zauberwort heißt Beteiligungsplanung und ist in der Schweiz mit ihrer direkten Demokratieform sicher leichter zu vermitteln als im benachbarten Deutschland.
KORA, das Kompetenzzentrum öffentlicher Raum, fördert den partizipativen Prozess und dient als Ansprechstelle für die Bevölkerung. Die Leitung obliegt dem Bereich Gestaltung + Nutzung des Tiefbauamtes und setzt sich aus Fachkräften der Verkehrsplanung, Stadtgrün Bern und dem Tiefbauamt zusammen. Weitere Amtsstellen aus anderen Direktionen sind beteiligt. KORA reagiert rasch und setzt nicht kommerzielle Ideen aus der Bevölkerung mit temporären Maßnahmen unkompliziert um. Für die Fachstelle Gestaltung und Nutzung öffentlicher Raum bieten die temporären Gestaltungsmaßnahmen und Pop-ups eine Chance, um mit der Schnelllebigkeit der Stadt mitzuhalten. Denn hier lässt sich Neues ausprobieren, langwierige Planungsprozesse überbrücken und die Bevölkerung aktiv mit einbeziehen.
Identifikationsstiftend und sensibilisierend wirken auch die großen und kleinen Begegnungszonen. Schon Anfang 2002 beschloss der Bundesrat die Möglichkeit, Begegnungszonen einzuführen. Fußgänger haben in derartigen Straßenabschnitten gegenüber dem Fahrverkehr Vortritt. Die Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge beträgt 20 km/h. Begegnungszonen gehören in der Stadt Bern inzwischen zu den etablierten Maßnahmen zur Erhöhung von Verkehrssicherheit und Wohnqualität. Ein bunter, niederschwelliger Flyer legt die Spielregel fest und ermuntert proaktiv zum Mitmachen. Viel Wert wird auf Eigenverantwortung der Initiatoren gelegt, sei es bei der gegenseitigen Rücksichtnahme, dem Sauberhalten oder der Gestaltung mit Farben und Einbauten. Die Referentin Petra Stocker vom Amt für Verkehrsplanung unterstützt dabei. Über 120 Begegnungszonen sind so bereits entstanden, auf dem Übersichtsplan machen die blau markierten Straßenzüge einen beachtlichen Anteil im Stadtgebiet aus und jährlich kommen weitere dazu.
3Neues Mindset
Bei den Gästen aus Deutschland macht sich nach den Vorträgen so etwas wie Neid bemerkbar. Nicht alles, was vorgestellt wurde, ist komplett neu, die meisten Bausteine, wie das Stockholmer Modell oder die Schwammstadt, sind in der Fachwelt schon länger bekannt und anerkannt. Es sind eher die kleinen Stellschrauben, die hier gedreht wurden und eine Lust am Ausprobieren spüren lassen. Woher kommt also dieser Mut, hat Bern als Hauptstadt traditionell eine Vorreiterrolle? „Das war nicht immer so“, stellt Tobias Würsch ehrlich fest: „ Aber dann hatten wir eine Stadträtin und Direktorin der TVS, die sich für den Langsamverkehr, die ‚Velo-Offensive‘, stark gemacht hat, was natürlich indirekt auch zur Klimaanpassung beiträgt. Die von ihr angestoßenen Veränderungen in der Verwaltung haben uns klar gemacht, dass wir Kompromisse finden müssen, um die Stadt weiterzubringen.“ Nach einer kurzen Verwirrung habe man sich zusammengerauft: Seit das neue Mindset in den Köpfen angekommen ist, ziehen alle an einem Strang.
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün
www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/tvs





















Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.