
Schmelzende Gewinne
Der Aufwand steigt, der Ertrag sinkt – so lässt sich das Marktgeschehen in Landschaftsarchitektur und Stadtplanung grob zusammenfassen. Tjards Wendebourg wertet das mindestens als Warnsignal.
von Tjards Wendebourg erschienen am 15.08.2025Was immer wieder vergessen wird: Auch wenn das Planen attraktiver Freiräume von vielen Menschen den schönen Künsten zugeordnet wird, so ist das Landschaftsarchitekturbüro ein Wirtschaftsbetrieb mit Gewinnerzielungsabsichten. Diese Tatsache mag nicht jede Kollegin oder jeder Kollege in gleicher Stringenz würdigen, aber je größer das Büro, desto ausgeprägter das Ziel. Denn die Kostenentwicklung kennt auch keinen Idealismus.
Da ist es keine gute Nachricht, dass in einer Umfrage der berufsständischen Vertretungen unter 2.500 Ingenieur- und Architekturbüros 16 % angeben, keinen Gewinn mehr zu machen – eine signifikante Verschlechterung zu 2024, wo es nur 3 % waren.
Nun ist angesichts des Marktumfeldes ein schlechtes Jahr für ein gutes Büro allemal zu verkraften. Schließlich gab es ja auch schon gute Jahre, in denen man hoffentlich einen Puffer aufgebaut hat. Allerdings steht zu befürchten, dass der schmelzende Gewinn kein kurzfristiges Problem ist, sondern sich auf eine Summe von Einwirkfaktoren zurückführen lässt. Viele davon sind strukturell und damit nur bedingt durch temporäre Flauten verursacht. Zwar wird die Flaute von den meisten Büros als Hauptursache für geringere Ertragskraft des eigenen Büros genannt. Aber schon auf Platz 2 (regulatorische Anforderungen) kommt ein struktureller Grund, dem auf Platz 4 (gestörte Projektabläufe) ein weiterer folgt. Zu Deutsch heißt das nämlich: Es gilt, immer mehr Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und die Projekte laufen nicht mehr so reibungslos – und damit in der Regel länger. Das führt automatisch zu höheren Kosten, die sich weniger automatisch refinanzieren lassen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Wir müssen mit immer weniger gut ausgebildeten Kräften – unter allen Baubeteiligten – bei zeitgleich immer höheren Anforderungen immer höhere Kosten erwirtschaften. Das grenzt an die Quadratur des Kreises und lässt sich erst mal nur dadurch auflösen, dass wir für bessere Honorierung kämpfen müssen. Denn höhere Kosten lassen sich bei Aufrechterhaltung gleichbleibender Qualität nicht mehr alleine durch gesteigerte Effizienz kontern; wobei letztere sicherlich in vielen Fällen noch möglich ist.
Langfristig wird uns nämlich die KI dabei helfen, besonders den strukturellen Problemen besser Herr zu werden. Erstens kennt ein gutes System alle gesetzlichen und normativen Regeln und kann sie viel besser in die planerischen Abläufe integrieren. Zweitens lassen sich per KI auch eine Reihe von Ablaufstörungen antizipieren oder – wenn das nicht möglich ist – automatisch für eine Nachtragsbegründung festhalten. Drittens wird es möglich sein, noch nicht voll ausgebildete „Fachkräfte“ digital an die Hand zu nehmen, um sie und das Büro vor Planungs- und Ausschreibungsfehlern zu bewahren. In einem suboptimalen System wird es also notwendig werden, sich mithilfe von Rechenleistung gegen mangelnde menschliche Verarbeitungskapazität zu wappnen.
Man sollte die Umfrageergebnisse erst mal nicht überbewerten. Eine durchschnittliche Schulnote von 2,9 im Hinblick auf die wirtschaftliche Situation ist immer noch befriedigend. Eine Warnung ist die rapide steigende Zahl der Büros ohne Gewinn aber allemal. https://bak.de/wp-content/uploads/2025/07/250721_Mitgliederbefragung_2025_extern.pdf




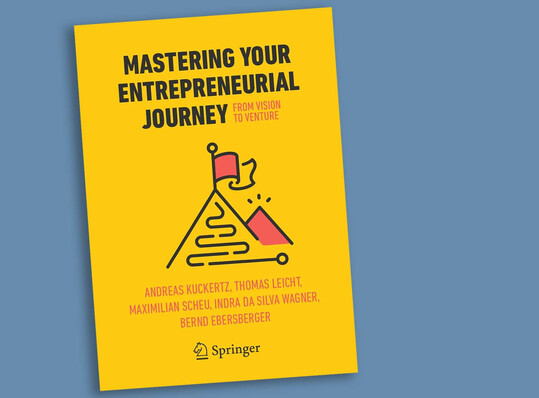







Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.