Projektunterstützung durch BIM
Building Information Modelling im Landschaftsarchitekturbüro ist häufig noch kein Standard. Adlerolesch Landschaftsarchitekten sind hier schon weiter: Sven-Marvin Sommer, BIM-Koordinator des Planungsbüros, gibt Einblicke, wie das Unternehmen BIM in seine Projekte integriert.
- Veröffentlicht am
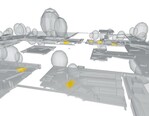
Digitaler Zwilling
"Das Modell ist der digitale Zwilling des Bauvorhabens“, erklärt Sven-Marvin Sommer. Der BIM-Koordinator des Planungsbüros adlerolesch studierte Landschaftsarchitektur, setzte seinen Fokus aber sowohl in der Bachelor-Arbeit als auch bei der Master-Thesis auf Building Information Modeling (BIM). Je nach vordefinierter Zielvorstellung werden in den verschiedensten Anwendungsfällen bei einem BIMProjekt unterschiedliche Merkmale im Modell hinterlegt. Das bildet die Basis für den gesamten Planungs- und Bauablauf. Die für die Anwendungsfälle definierten Merkmale richten sich unter anderem nach den Leistungsphasen und reichen für die Massen- und Kostenermittlungen, für die Ausschreibung und ebenso für die verschiedensten Prüfkriterien, denen sich das Bauvorhaben im Projektverlauf stellen muss – von der Normgerechtigkeit bis hin zu Nachhaltigkeitsfragen.
BIM und Nachhaltigkeit
Denn – sofern eine Fragestellung quantifizierbar ist, ist sie über das BIM-Modell auch lösbar. Das gelte auch für die Nachhaltigkeit, so Sommer. Eine Vorgabe der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) gibt es dazu bisher nicht. Für eine projektübergreifende und transparente Einschätzung zur Nachhaltigkeit einer Freianlage müsste der Leitfaden erst weiterentwickelt werden. Die Untersuchung, wie BIM Nachhaltigkeitsaspekte unterstützt, war Thema seiner Masterarbeit an der Hochschule Osnabrück („Potentiale der BIM-Methode für die modellbasierte Nachhaltigkeitsprüfung von Außenanlagen“), die Sommer 2020 abschloss. Inhaltlich setzte er sich einen attraktiven Schwerpunkt: Das Managen von Freianlagen, was in Kombination mit BIM als großes Zukunftsthema erachtet wird.
Zuvor studierte Sommer in Freising Landschaftsarchitektur, seine Bachelorthesis „BIM in der Landschaftsarchitektur“ setzte den Fokus auf Standardisierungen und Datenbanken. Parallel zum Folgestudium in Osnabrück startete Sommer bei adlerolesch in Nürnberg als Werkstudent.
BIM-Projekte und BIM-Unterstützung
BIM im Planeralltag – bei adlerolesch ist das seit gut zwei Jahren der Fall – letztlich seitdem der frühere Werkstudent Sommer nach seinem Masterabschluss zurück ins Büro kam und sein Wissen nun in Vollzeit in das Unternehmen einbringen kann. Aktuell bearbeitet das Landschaftsarchitekturbüro zwei Projekte, die komplett über BIM abgewickelt werden. Zusätzlich unterstützt BIM laufende „klassische“ Projekte mittels Prüfmodellen. So lassen sich Varianten während der Vorentwurfsphase zum Beispiel bezüglich ihrer Flächenversiegelung vergleichen oder Ausführungsplanungen hinsichtlich ihrer Baubarkeit und Normenkonformität überprüfen.
AIA und BIM-Ziele definieren
Bei den beiden Projekten „Schulhofplanung“ und „Kammerspiele in Ingolstadt“ kommt BIM bereits von Anfang an zum Einsatz. Sommer kümmert sich als BIM-Koordinator des Unternehmens um das Modellieren, Beschreiben und Überprüfen sowie den Datenaustausch mit den Projektpartnern. Die Gesamtkoordination übernehmen bei beiden Projekten die Hochbauarchitekten, da diese die Hauptgewerke der beiden Bauvorhaben sind. Obwohl die jeweilige Projektsteuerung in den Händen erfahrener Projektsteuerer liegt, ist das Fachmodell „Landschaft“ auch für diese teils noch Neuland: „Anfangs ist es meist ein dynamischer Prozess, da die meisten Projektsteuerer noch nicht wissen, wie Landschaftsmodelle aussehen“, sagt Sommer. Entsprechend seien die AIAs (Auftraggeber-Informations-Anforderungen) und BIM-Ziele für das Gewerk nicht immer klar definiert. Das eigene Projektmanagement unterscheidet sich von klassischen Projekten, da sämtliche Daten in den jeweiligen Modellen abgelegt werden. „Das 3D-Modell ist als Inhaltsverzeichnis zu verstehen“, sagt Sommer.
Qualitätskontrolle möglich
Aber nicht nur Datensammlung, deren Bündelung und Austausch ermöglicht das Modell. Auch eine Qualitätskontrolle und -sicherung ist möglich: So konnte Sommer nach Abschluss der Entwurfsplanung für ein Schulhofprojekt in wenigen Arbeitsschritten kontrollieren, ob das Pflanzlochvolumen für die geplanten Hochstämme eine normgerechte Größe gemäß den FLL-Richtlinien aufweist. Wenige Klicks genügten, um kleinere Volumina als 12 m³ aufzufinden und diese farblich zu markieren. Den Projektpartnern lässt sich so das Problem visuell aufzeigen und eine alternative Lösung unterbreiten – diskutiert wurden Anpassungen der Pflanzenauswahl oder des Entwurfs, um ein entsprechendes Wurzelvolumen zu ermöglichen.
Modellbasierte Auswertung
Modellbasierte Auswertungen lassen sich auch zu Nachhaltigkeitsthemen finden. Wichtig ist immer eine klare Fragestellung – in einem weiteren Anwendungsbeispiel untersuchten die Planer zwei Varianten hinsichtlich ihrer Flächenversiegelung und Stellplatzpotenzials und verglichen sie mit dem Bestand. Die Fragen waren entsprechend gegliedert:
- Was beinhaltet der Bestand?
- Welches Stellplatzpotenzial liegt in welcher Planungsvariante vor?
- In welchem Verhältnis steht in diesem Zusammenhang die Flächenaufteilung?
Vergleich der Varianten
Das Modell wertete die Flächenaufteilung in Prozent aus sowie das Stellplatzpotenzial der jeweiligen Variante. Durch die Fragestellungen lassen sich die Nachhaltigkeitsaspekte zur jeweiligen Flächenversiegelung je Variante und dem Erhalt des Altbestands prüfen, da sie quantifizierbar und in ein Verhältnis zum Nutzen (hier der Anzahl der Stellplätze) gestellt werden können. Ein Punktesystem ermöglicht die Projektübergreifende und transparente Betrachtung der Nachhaltigkeit.
Im konkreten Fall ließ sich der Istzustand mit 30 % Flächenanteil und einem Parkangebot von 205 Stellplätzen in klare Relation stellen zu den beiden Varianten – Variante 1 etwa ermöglichte bei gleichem Flächenverbrauch ein gesteigertes Parkangebot auf insgesamt 326 Stellplätze. Die Effizienz der Stellplatzplanung hing im Wesentlichen von den Fahrgassen ab.
Einsatzmöglichkeiten
Neben der klassischen digitalen Massenermittlung lassen sich Kostenelemente an digitale Bauteile anhängen. Durch Filterfunktionen in der AVA können die Anwender daraus einen Multimodellcontainer (MMC) erstellen: Es entsteht eine transparente nachvollziehbare Kostenermittlung. Grundlegend für die BIM-Methode ist eine modellbasierte Projektabwicklung, dabei lassen sich Regelprüfungen in verschiedensten Anwendungsfällen anwenden. Das Ziel sei schließlich, Probleme bereits vor dem Bau aufzudecken und Kollisionen zu vermeiden, so Sommer.
Die eigentliche Herausforderung bei BIM-Projekten sei aber eine andere: Die Entscheidung, welche Daten überhaupt erhoben werden. Denn nicht immer ist zu Beginn ersichtlich, welche Anwendungsfälle der Bauherr für das erfolgreiche Managen seiner Freianlage braucht. „Gerade zu Beginn des Projekts muss der Bauherr noch intensiv betreut werden“, resümiert Sommer.



Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.